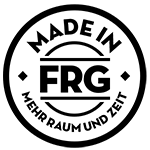Neuschönau. Es ist ein mystisches Naturidyll mitten im Nationalpark Bayerischer Wald. Weit weg von markierten Wegen. Und es war der ständigen Gefahr des Verschwindens ausgesetzt – zumindest bis jetzt. Gemeint ist der Moorkomplex Tieffilz unterhalb des Lusens. Damit der einzigartige Lebensraum erhalten bleibt, arbeiteten in den vergangenen zwei Wochen rund 40 Freiwillige Hand in Hand bei einer Renaturierungsmaßnahme mit. Nun schaut die Zukunft des rund zwei Hektar großen Areals wieder rosig aus.
Einst wurde die Fläche in der Senke zwischen Sulzriegel und Hohem Filzberg von Förstern entwässert, um dort Waldwirtschaft betreiben zu können. Ganz ließ sich das Moor aber nicht besiegen. Die Entwässerungsgräben legten trotzdem Teile des sumpfigen Bereichs trocken. Schon vor 25 Jahren wurde versucht, dies zu reparieren. Jedoch nur mit bedingtem Erfolg. „Ein paar der damaligen Dämme waren zwar erhalten, drohten aber akut zu brechen“, erklärt Moorexpertin Claudia Schmidt von der Nationalparkverwaltung. „Wäre das passiert, wären wir Gefahr gelaufen, dass das Filz doch noch kaputt geht.“

Um die Bretter für die Spundwände in den Boden der einstigen Entwässerungsgräben zu rammen, war einiges an Kraftanstrengung nötig.
Also wurde die Fläche in ein aktuell laufendes, von der EU und dem Bayerischen Naturschutzfonds kofinanziertes LIFE+ Projekt des Nationalparks mit aufgenommen, das sich den Erhalt von Fließgewässern, Schachten und Mooren auf die Fahne geschrieben hat. Für die anstrengenden Arbeiten vor Ort wurde das Bergwaldprojekt mit ins Boot geholt. Zwei Teams von je 20 Frauen und Männern rückten an, um sich abseits der Zivilisation für Natur- und Klimaschutz einzusetzen.
Das benötigte Material, neben Brettern allein 120 Kubikmeter Sägemehl und Hackschnitzel, wurde bereits vorab mit einem Helikopter ins Projektgebiet geflogen. Werkzeug, Verpflegung und Co. musste jedoch von den Helfern selbst angeschleppt werden – in einem rund 45-minütigen Fußmarsch ab Tummelplatz. Und das täglich. „Dieses ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung“, lobt Nationalparkleiter Franz Leibl. „Es dient dem Klimaschutz ebenso wie dem Erhalt bedrohter Moorarten.“

Sichtbarer Erfolg der Renaturierung: Durch das Verschließen der Gräben stieg der
Wasserstand im Tieffilz merklich an.
Unter der Anleitung erfahrener Projektleiter bauten die Helfer neue Spundwände, die das Wasser wieder im Moor halten. Die Holzbauwerke wurden mit Füllmaterial komplett abgedeckt. „Somit sind die Dämme luftdicht verpackt“, erklärt Schmidt. „Dank der so geschafften Konservierung sind wir optimistisch, hier nun endgültig für eine gelungene Renaturierung gesorgt zu haben.“Das Ökosystem im Tieffilz kann so seine Funktionen als Wasser- und Kohlenstoffspeicher in Zukunft wieder besser entfalten. In naturnahen Mooren werden dauerhaft Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid gespeichert. Die Renaturierung ist also vorbeugender Klimaschutz erster Güte.
„Außerdem sind Moore wichtige Rückzugsräume für seltene Tier- und Pflanzenarten“, so Henning Rothe vom Bergwaldprojekt. Im Tieffilz kommen schon jetzt Spezialisten wie Rosmarinheide, Moosbeere oder Wollgras vor. Demnächst wohl wieder in noch höherer Anzahl.
 Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald